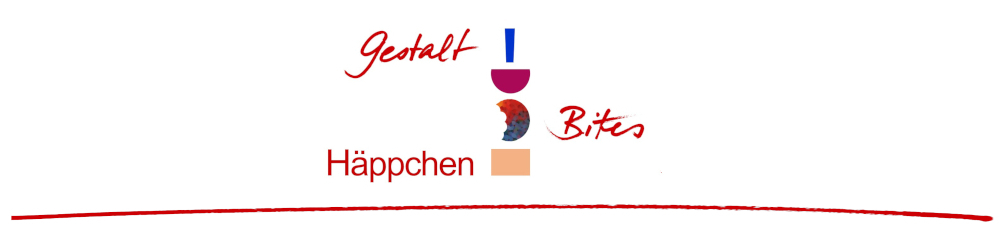... newer stories
Freitag, 12. Juli 2019
Der innere Quatschi: Wirklich so ein Nervtöter?
ahc, 11:29h
In einem meiner sehr eindrucksvollen Ausbildungsseminare (Danke, Peter) zum Thema, wie man mit seinem inneren Kritiker umgehen kann, kam das Bild des Quatschis auf, diesem nervtötenden Etwas, manchmal auch Über-Ich genannt, das einem permanent auf der Schulter sitzt oder im Nacken hängt, um einen ununterbrochen zu bewerten, meist im Stil eines Abwertens und nicht Aufwertens! Das Bild blieb sofort bei mir hängen und schien in meinen Erfahrungshorizont zu passen; auch die Begegnungsmöglichkeiten für dieses Etwas erschienen mir augenblicklich sinnvoll.
Dann stieß ich auf einen Artikel im Psychological Bulletin (einer der qualitativ hochwertigsten Journale der Amerikanischen Vereinigung für Psychologie) mit dem Namen „Inneres Sprechen: Entwicklung, kognitive Funktionen, Phänomenologie und Neurobiologie“ (Übers. ahc). Mein Interesse war im Nu geweckt! Was sagt denn die Psychologie zum allgegenwärtigen Quatschi? Ist er wirklich so ein Nervtöter?
Die in der Wissenschaft weit verbreitetste Antwort passt natürlich auch in diesem Fall: Es kommt drauf an, wie man es sieht! Und eigentlich wollte ich in diesem ersten Häppchen für mein Blog einen kurzen Überblick über Alderson-Day und Fernyhoughs (2015) Review geben, bis ich, meiner Neugier folgend, eine andere Spur in besagtem Paper fand. Diese Spur führte mich eigentlich zu etwas sehr Gestaltischem, das jedoch den gängigen Annahmen zum Quatschi teilweise entgegensteht (oder ich sollte wohl besser wieder sagen, je nachdem wie man es sieht). Beide Aspekte, also die Hauptideen des Papers und meine Vorliebe für eine bestimmte Denkrichtung sollen in diesem Häppchen leserfreundlich wiedergegeben und für die Gestalttherapie abgeklopft werden.
Was sagt die Psychologie zum inneren Quatschi?
Natürlich ist ein Review nicht die Psychologie, aber in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, einen systematischen Überblick über ein Forschungsgebiet zu bekommen – die Ozeane an Veröffentlichungen und die Diversität der Meinungen wird immer komplexer (in einem Artikel, den ich nicht mehr finden kann, hieß es, dass heute mind. 40 Forscher für den gleichen Erkenntnisgewinn gebraucht werden wie früher ein Forscher) und die Originalarbeiten immer mehr auf winzige Details fokussiert. Dennoch stellt für mich ein Review (35 Seiten lang mit 9 Seiten Literaturverzeichnis) im Psychological Bulletin einen wichtigen, verlässlichen Referenzpunkt dar.
Erst mal lernen wir, dass unser Quatschi viele Namen haben kann (S. 931):
Verbales Denken (verbal thinking), inneres Sprechen (inner speaking), verdecktes Selbstgespräch (covert self-talk), interner Monolog (internal monologue), interner Dialog (internal dialogue), u.v.a. – so weit alles verständliche Ausdrücke, die als Schlagworte für weiterführende Recherchen gut genutzt werden können.
Wir lernen danach sofort, dass diese Selbstgespräche zwar enorm wichtige Themen für die kognitive Forschung sein müssten, aber nicht sind, weder für kognitive Neurowissenschaftlerinnen, noch für Psychologen – und das im Jahr 2015! Wilhelm Wundt würde sich im Grabe herumdrehen, obwohl es angeblich wieder kleine Tendenzen gibt, Introspektion und innere Erfahrungsprozesse mehr in die Theoriebildung einfließen zu lassen. Problem ist für die Forschung, dass diese Erlebnisse nicht direkt beobachtbar sind (was sie nicht weniger wichtig macht – Wundt wusste schon, warum er nicht nur auf eine Form von Psychologie setzte!).
Theoretisch stützen sich die meisten Forschungsergebnisse zum inneren Sprechen zwischen 1980 und 2014 auf zwei Perspektiven: Vygotskys kognitive Entwicklungstheorie, die auch die Verinnerlichung von Sprache beschreibt, und Theorien zum Arbeitsgedächtnis, besonders die von Baddeley und seinem Konstrukt der phonologischer Schleife (phonological loop). Erstere kann sehr gut zur Gestalttherapie in Bezug gesetzt werden (besonders die Betonung der dialogischen Qualität von innerer Sprache, vgl. auch Staemmler, 2012, Kap. 6), während mir bei der zweiten höchstens einleuchtet, dass das innere Wiederholen einen Telefonnummer dazu führt, dass ich sie besser behalte – ein Anwendungsaspekt der phonologischen Schleife, der mich nur über Umwege zu Ideen der Gestalttherapie zu führen vermag (z.B. die Frage, mit welchen Mikroschritten kommt der Quatschi in den Menschen?). Natürlich hat letztere Theorie auch einiges über die Fähigkeit zu planen etc. zu sagen. Augenscheinlich scheinen sich beide Theorien ungeachtet ihrer konkreten Anwendungsaspekte und abzüglich einiger Kritikpunkte mehr oder weniger bewährt zu haben.
Am schwierigsten ist die methodologische Erfassung von innerem Sprechen, da es ja nicht von außen erfassbar ist, sondern immer nur von Berichten über das innen Erlebte herrührt. Es gibt mittlerweile alle möglichen Versuche: Fragebögen, auf der Teilnehmende Selbsteinschätzungen vornehmen können (Beispielitem: „In meinem Kopf spreche ich kritisch zu mir selbst“ - „In my head I talk to myself a critical way“), die zwar relativ reliabel aber – wenig verwunderlich – nicht sehr valide sind; Zufallsstichprobenziehungen von Erfahrungen zu unterschiedlichen Tageszeiten (z.B. nach einem zufälligen Piepton), die dann, je nach Instrument, auf bestimmte Weise berichtet werden müssen; die Beobachtung von privatem Sprechen (als Proxy für inneres Sprechen), was allerdings nicht unbedingt parallel zu innerem Sprechen verläuft und so der Transfer zumindest in Frage gestellt werden kann; Verhindern von innerem Sprechen und die Messung von Auswirkungen davon auf andere Aufgabenbereiche; Induktion von inneren phonologischem Erleben, z.B. das Beurteilen, ob sich etwas reimt, wobei auch hier der Transfer schwierig wird, da auch das orthographische Erleben zu richtigen Bewertungen führt; Neurobildgebung und neuropsychologische Methoden, bei denen Teilnehmende aufgefordert werden, innerlich zu sprechen und dann gleichzeitig ihreGehirnaktivität gemessen wird.
Und was sagt uns die Forschung basierend auf diesen Methoden, mit all ihren Vor- und Nachteilen, jetzt über unserem Quatschi?
Entwicklungspsychologisch gesprochen entwickelt sich die Fähigkeit, phonologische Informationen im Gedächtnis zu behalten bei Kindern ungefähr im Alter von 18 Monaten und privates Sprechen, meist als Kommentar zu einer gerade ausgeführten Tätigkeit zwischen 2-3 Jahren. Dieses private Sprechen wandert ca. im Alter von 5 Jahren „in den Untergrund“ (S. 935) und wird somit zu innerem Sprechen, bleibt aber oft auch noch bis ins Erwachsenenalter bestehen. Privates Sprechen kommt bei Kindern häufiger vor, wenn noch eine Person anwesend ist, bei innerem Sprechen macht eine weitere Person keinen Unterschied, was auf eine zusätzliche soziale Funktion von privatem Sprechen (nicht jedoch innerem Sprechen) hinweist. Im Alter von 7 Jahren scheinen phonologische Elemente von Wörtern für das Erinnerungsvermögen eine Rolle zu spielen, vorher nicht, ein Ergebnis, das derzeit jedoch wieder in Frage gestellt wird. Allerdings scheinen jüngere Kinder inneres Sprechen nicht spontan zu benutzen. Und wie erleben Kinder inneres Sprechen? Schwer zu sagen, weil Kinder oft wenig Lust haben, über inneres Sprechen zu berichten. Meinungen reichen von „Kinder sprechen innerlich gar nicht (wie Erwachsene)“ bis „imaginäre Gefährten sind unweigerlich mit innerem Sprechen verbunden“.
Und Erwachsene? Die bräuchten den Quatschi eigentlich gar nicht für logische Aufgaben oder sogar verbales Material. Beim inneren Lesen lösen meist nur komplexe Texte Erfahrungen von innerem Sprechen aus. Für die Gestalttherapie höchst interessant sind die Befunde zum Selbstgespräch auf Motivation und Verhalten: Fragen à la „Werde ich das schaffen?“ führten zu besserer Motivation als deklarative Formen „Ich schaffe das!“, Ansprachen in der zweiten Person „Du schaffst das!“ zu besseren als Selbstaussagen in erster Person „Ich schaffe das!“ Das weist auf eine Verinnerlichung von vergangenen Ansprachen durch andere Personen hin (vermeintlich soziale Ursprünge), also die Idee der Introjektion. Es wäre sicher wertvoll, diese Forschungsrichtung genauer anzuschauen, besonders, da ich in der PsycINFO-Datenbank keinerlei Einträge zu „Sprache der Verantwortung“ oder ähnlichem außerhalb des Dunstkreises von theoretischer Psychologie mit Schwerpunkt auf Existentialismus finden konnte. Die o.g. Selbstgesprächeforschung weist jedoch deutlich darauf hin, dass kleine Veränderungen in der Wortwahl und Grammatik große Unterschiede in anderen Phänomenen ausmachen, was die Gestalttherapie ja auch annimmt.
Erwähnt wird außerdem noch der Überschattungseffekt von Sprache auf Gedächtnisleistung. Salopp ausgedrückt besagt dieser, dass meine Erinnerung an eine Szene sich verschlechtert, sobald ich eine Szene mit Worten beschreibe (um genau zu sein, um 4-16%), sprich eine Art „Kontamination des Gedächtnisinhalts“ durch Versprachlichung. Zwar ist das seit Loftus ja schon bekannt, aber so wie in diesem Review beschrieben stelle ich mir die Frage, ob das für die Gestalttherapie heißen könnte, (a) nicht immer alles in Worte fassen zu lassen, (b) dies als wünschenswerten Effekte mehr zu nutzen, oder (c) oder es als normalen Vorgang im immerwährenden Fluss der Awareness einfach anzunehmen. Es kommt wahrscheinlich drauf an.
Besonders interessant für die Gestalttherapie sind die Ergebnisse zu den Sprachinhalten des inneren Sprechens. Hier fällt auf, dass die meisten Forschungsgruppen sich auf die Erforschung von Kontext und Funktionen des inneren Sprechens beschränken, und nur wenig über die Inhalte zu sagen haben. Auf den ersten Blick lesen sich die (wenigen) Befunde jedoch wie eine überwältigende Bestätigungswelle für den Quatschi:
„Verbreitete Inhalte des inneren Sprechens waren an sich selbst adressierte Bewertungen und emotionale Zustände, während mnemonische Funktionen (Erinnerungen daran, etwas zu tun) als weit verbreitetste Funktionen aufgelistet wurden.“ (S. 940, left column)
„Von diesen [vier Faktoren, nämlich: dialogisches innere Sprechen, kondensiertes inneres Sprechen, andere Menschen im inneren Sprechen und evaluatives/motivationales inneres Sprechen] war besonders der evaluative/motivationale weit verbreitet: 82,5% der Antworten verwiesen auf wenigstens einige Erfahrungen mit diesen Charakteristiken. Das dialogische innere Sprechen war fast genau so verbreitet (77,2%) […] Evaluatives inneres Sprechen und die Anwesenheit anderer Menschen im inneren Sprechen standen beide in positivem Zusammenhang mit Trait-Angst und, etwas schwächer, mit Depression. […] [E]valuatives inneres Sprechen, aber keine anderen Formen des inneren Sprechens, sagten geringeres globales Selbstwertgefühl voraus.“ (S. 940, right column, freie Übers. ahc)
Allerdings wird das Bild komplexer, wenn man sich die Details ansieht, auf denen diese Ergebnisse basieren, nämlich meist auf Selbstbewertungsfragebögen. Ungeachtet der Probleme von Fragebögen allgemein scheint zwar klar zu werden, dass eine große Mehrheit Erfahrungen mit dem bewertenden Quatschi hat und auch mit dem, was Perls Topdog-Underdog nennt (wenn ich einmal dialogisches Sprechen als eine Form davon ansehe), allerdings bleibt unklar inwiefern (a) die Teilnehmenden so eine Einschätzung überhaupt genau genug vornehmen können (ich weiß zumindest nicht immer, was/wie ich zu mir spreche) und (b) wie oft am Tag dies passiert. Die genannten 82,5% sind eine Zusammenfassung von verschiedensten Informationen: Es wurde geschaut, wie viele der Teilnehmenden Items der evaluativ/motivational Subskala mit „trifft mit Sicherheit auf mich zu“, „trifft möglicherweise auf mich zu“, und „wenn überhaupt, trifft ein kleines Bisschen auf mich zu“ angekreuzt hatten. Selbst wenn man mal davon absieht, dass „trifft möglicherweise auf mich zu“ auch beinhaltet, das es „möglicherweise nicht“ zutrifft (möglicherweise eben), haben insgesamt nur 34.5% wirklich „trifft mit Sicherheit auf mich zu“ angegeben. In einer Neufassung des Fragebogens (Alderson-Day et al. 2018), wurde die Skala auf sieben Abstufungen (statt vorher sechs) verändert und die Antwortmöglichkeiten bilden nicht mehr das „Zutreffen“ dieses Phänomens ab, sondern die Häufigkeit des Auftretens (von nie bis immer). Hier finden wir zwar auch für evaluatives/motivationales inneres Sprechen den höchsten Mittelwert (29,96, SD=7,28), aber bei einer Höchstausprägung bei 7 Items von 49 ist das weit entfernt von immer; 26% geben an, immer oder sehr oft evaluativ/motivational innerlich zu sprechen, aber es gibt auch 18%, die dies nie oder sehr selten zu tun glauben. Außerdem besteht zumindest bei einem Item dieser Skala eine Vermischung von Inhalt und Folgen („Mein inneres Sprechen führt dazu, dass ich mich niedergeschlagen und depressiv fühle.“ Item 24).
Diese vielen Bedenken haben mich auf die Spur einer anderen Methodik gebracht, die ebenfalls erwähnt, aber nicht besonders ausgeführt wird, die einer sehr phänomenologischen Methodik von Russell Hurlburt, genannt Descriptive Experience Sampling (DES; deskriptives Erfahrungsstichprobenziehen). Diese Methodik versucht, alle Vorannahmen über inneres Sprechen auszuklammern und rein phänomenologisch zu erfragen, was sich einer Person kurz (1 Sekunde) vor einem während eines normalen Tages platzierten und zufällig ausgelösten Piepton gerade gewahr gewesen ist. Sechs Erfahrungen pro Tag werden jeden Abend per Interview und anhand der Aufschriebe der Versuchspersonen näher beleuchtet, wobei darauf geachtet wird, so nah wie möglich am Phänomen zu bleiben. Ähnlich wie bei Ausbildungsseminaren zur Gestalttherapie stellten die Forscher fest, dass die Versuchspersonen anfänglich sehr stark interpretierten und erst nach einigen Rückmeldungen im Interview phänomenologisch orientiert beschreiben lernten. Diese sogenannte „iterative Verbesserung“ lässt einmalige Untersuchungsansätze noch zweifelhafter erscheinen. Hurlburt und seine Kollegen haben eine Reihe von sehr interessanten Ergebnissen zutage gebracht, die ich aufgrund der vielen Bezüge zu dem, was wir in der Gestalttherapie annehmen, in einem weiteren Häppchen noch aufbereiten werde. Zum inneren Sprechen sei berichtet, dass nur 20-25% der Zufallsstichproben inneres Sprechen zutage brachten und Hulrburts
Ergebnisse somit der oft postulierten Annahme, Menschen würden permanent zu sich sprechen, entgegensteht. Die Art und Weise wie Menschen innerlich sprechen unterscheidet sich auch stark, ist also sehr idiosynkratisch, und während es tatsächlich wenige Menschen gibt, die permanent mit sich zu sprechen scheinen, gibt es ebenso Menschen, die gar nicht innerlich sprechen. Es besteht also offensichtlich eine gewisse Überschätzung des Quatschi.
Von der Qualität des Sprechens her, hören sich die meisten Menschen in ihrer eigenen Stimme mit dem ihr typischen Rhythmus, der ihnen typischen Geschwindigkeit und Tonlage wie in ihrer externen Stimme; das Sprechen findet typischerweise in ganzen Sätzen statt und innere Sprecher benutzen dieselben Wörter wie beim externen Sprechen, dieselben emotionalen Färbungen und erleben sich eher als aktiv das Sprechen kreierend (vs. passiv hörend). Inneres Sprechen scheint sich zu unterscheiden von innerem Hören, nicht-symbolischen Denken, sensorischem Gewahrsein (oder in Gestaltsprache, der äußeren Zone), und Denken als rein kognitivem Prozess (S. 941).
Eine Frage, die noch im Raum steht ist inwieweit inneres Spreche und externes Sprechen verbunden sind und wenn wie. Während oft starke Ähnlichkeit in den beiden Sprechebenen berichtet wird, gibt es auch viele Unterschiede. Manche Forscher sprechen davon, dass inneres Sprechen eine verarmte Version des externen Sprechens ist, andere davon, dass inneres Sprechen lediglich die Funktion habe, Fehler in der Produktion von externem Sprechen zu überwachen. Interessante Studien, die z.B. finden, dass Zungenbrecher bei innerem Sprechen nicht passieren basieren jedoch ausschließlich auf Berichten der Versuchspersonen. Hurlburt wiederum findet, das das Zeitempfinden beim inneren Sprechen nicht den herkömmlichen Regeln der Physik entspricht, sondern viele innere Sprecher gefühlt gleichschnell sprechen wie sonst beim externen Sprechen, das aber in Bruchteilen von Sekunden passiert. Eine Unmöglichkeit, die auf große Unterschiede hinweist.
Die Ergebnisse zu innerem Sprechen und Gehirn hier zu referieren, gehen über diese Häppchen leider hinaus. Bisher gibt es viele sich widersprechende Befunde, die bisher zu keiner Bevorzugung eines bestimmten Modells geführt hat, was auch an der Komplexität der Materie liegt. Die sensumotorische Aktivität (zum Bewegen der notwendigen Körperteile zum externen Sprechen), die auch bei innerem Sprechen vorkommt wird oft mit einem sog. somatosensory forward model erklärt. Darin werden sensumotorische Aktivitäten top-down aktiviert, also vorweggenommen, und basieren nicht auf tatsächlich stattfinden sensumotorischen Aktivitäten, die wiederum zu solchen Signalen führen würden. Größtes Problem ist jedoch die ökologische Validität von solchen Studien, da die bisher vorhandenen Setups von fMRI-Scannern doch starke Beeinträchtigungen mit sich bringen.
Mit Spracherfahrungslänge scheint auch die Häufigkeit von innerem Sprechen einher zu gehen. Lerner einer Zweitsprache sprechen innerlich erst mit fortschreitendem Lernniveau auf der neuen Sprache und Menschen mit geringer Lesekompetenz benutzen, ganz im Sinne von Vygotsky, eher privates Sprechen denn inneres Sprechen. Auch blinde Menschen zeigen häufiger privates Sprechen (= Zeichensprache ausschließlich für private Nutzung) als Sprechende, wobei es noch nicht genügend phänomenologische Studien mit Blinden zu dem Thema gibt.
Weitere Themen werden noch in dem Review angeschnitten (z.B., die Beziehung zwischen innerem Sprechen und in Gedanken abschweifen, inneres Sprechen in atypischen Populationen wie z.B. die Abwesenheit von innerem Sprechen bei Störungen des Autistischen Spektrums, Versuch einer ersten Integration in ein noch sehr abstraktes Multikomponentenmodell und die Diskussion, ob inneres Sprechen überhaupt notwendig wäre), die sich aber immer weiter vom Quatschi entfernen. In ihrer Schlussfolgerung sind zwei Aussagen der Autoren hervorzuheben: einmal, dass das Phänomen des inneren Sprechens auch weiterhin paradox ist, und dass es eine große interindividuelle Variabilität des Phänomens gibt. Persönlich glaube ich derzeit, dass die o.g. Ergebnisse, die Häufigkeit des Quatschis durchaus in Frage stellen, was aber nicht bedeutet, dass er weniger nervtötend sein muss oder gar ausgedient hätte. Vielmehr wäre es spannend herauszufinden, in welchen anderen Modalitäten außer Sprache er vorkommen könnte. Bewerten und Abwerten muss ja nicht zwingend über Sprache passieren, sondern kann schon mit einem inneren Seufzer, einem Blick, einer Bewegung, einer diffusen emotionalen Reaktion etc. Einfluss nehmen. Gleichzeitig ist auch hier eine phänomenologische Grundhaltung wichtig, dass ich eben nicht schon an einen Quatschi einer bestimmten Form glaube (und ihn dann auch finde), sondern sich bestimmte Phänomene mit hoher Glaubhaftigkeit zeigen und ich sie dann Quatschi im Sinne eines nervtötenden Abwerters nennen kann. Das Eintreten in einen immerwährenden Überprüfungsprozess unserer Vorannahmen ist auch für die Gestalttherapie wichtig und kann m. E. nicht nur theorieimmanent vollzogen werden. Natürlich bleibt der Klient bei uns Hegemon seiner Interpretationen und demnach ist es im Gegensatz zur Grundlagenforschung weniger wichtig, ob das, was er interpretiert, nun wirklich seiner täglichen Erfahrung entspricht (die Tatsache, dass die Klientin an eine bestimmte Interpretation glaubt hat ja an sich schon Einfluss), gleichzeitig ist es für mich als geschulte Therapeutin doch auch wichtig einschätzen zu können, wie solche Selbstüberzeugungen zustande kommen und in welchem Verhältnis sie zu anderen Interpretationen und Befunden stehen. Und hier muss ich evtl. noch mehr als sonst die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass einige Menschen eben gar nicht innerlich sprechen und dementsprechend möglicherweise auch nicht in gleicher Weise vom Quatschi heimgesucht werden.
Basierend auf:
Alderson-Day, B., & Fernyhough, C. (2015). Inner speech: Development, cognitive runctions, phenomenology, and neurobiology. Psychological Bulletin, 141(5), 931–965. https://doi.org/10.1037/bul0000021
Zitierte Literatur:
Staemmler, F.-M. (2012). Empathy in psychotherapy: How therapists and clients understand each other. New York: Springer.
Dann stieß ich auf einen Artikel im Psychological Bulletin (einer der qualitativ hochwertigsten Journale der Amerikanischen Vereinigung für Psychologie) mit dem Namen „Inneres Sprechen: Entwicklung, kognitive Funktionen, Phänomenologie und Neurobiologie“ (Übers. ahc). Mein Interesse war im Nu geweckt! Was sagt denn die Psychologie zum allgegenwärtigen Quatschi? Ist er wirklich so ein Nervtöter?
Die in der Wissenschaft weit verbreitetste Antwort passt natürlich auch in diesem Fall: Es kommt drauf an, wie man es sieht! Und eigentlich wollte ich in diesem ersten Häppchen für mein Blog einen kurzen Überblick über Alderson-Day und Fernyhoughs (2015) Review geben, bis ich, meiner Neugier folgend, eine andere Spur in besagtem Paper fand. Diese Spur führte mich eigentlich zu etwas sehr Gestaltischem, das jedoch den gängigen Annahmen zum Quatschi teilweise entgegensteht (oder ich sollte wohl besser wieder sagen, je nachdem wie man es sieht). Beide Aspekte, also die Hauptideen des Papers und meine Vorliebe für eine bestimmte Denkrichtung sollen in diesem Häppchen leserfreundlich wiedergegeben und für die Gestalttherapie abgeklopft werden.
Was sagt die Psychologie zum inneren Quatschi?
Natürlich ist ein Review nicht die Psychologie, aber in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, einen systematischen Überblick über ein Forschungsgebiet zu bekommen – die Ozeane an Veröffentlichungen und die Diversität der Meinungen wird immer komplexer (in einem Artikel, den ich nicht mehr finden kann, hieß es, dass heute mind. 40 Forscher für den gleichen Erkenntnisgewinn gebraucht werden wie früher ein Forscher) und die Originalarbeiten immer mehr auf winzige Details fokussiert. Dennoch stellt für mich ein Review (35 Seiten lang mit 9 Seiten Literaturverzeichnis) im Psychological Bulletin einen wichtigen, verlässlichen Referenzpunkt dar.
Erst mal lernen wir, dass unser Quatschi viele Namen haben kann (S. 931):
Verbales Denken (verbal thinking), inneres Sprechen (inner speaking), verdecktes Selbstgespräch (covert self-talk), interner Monolog (internal monologue), interner Dialog (internal dialogue), u.v.a. – so weit alles verständliche Ausdrücke, die als Schlagworte für weiterführende Recherchen gut genutzt werden können.
Wir lernen danach sofort, dass diese Selbstgespräche zwar enorm wichtige Themen für die kognitive Forschung sein müssten, aber nicht sind, weder für kognitive Neurowissenschaftlerinnen, noch für Psychologen – und das im Jahr 2015! Wilhelm Wundt würde sich im Grabe herumdrehen, obwohl es angeblich wieder kleine Tendenzen gibt, Introspektion und innere Erfahrungsprozesse mehr in die Theoriebildung einfließen zu lassen. Problem ist für die Forschung, dass diese Erlebnisse nicht direkt beobachtbar sind (was sie nicht weniger wichtig macht – Wundt wusste schon, warum er nicht nur auf eine Form von Psychologie setzte!).
Theoretisch stützen sich die meisten Forschungsergebnisse zum inneren Sprechen zwischen 1980 und 2014 auf zwei Perspektiven: Vygotskys kognitive Entwicklungstheorie, die auch die Verinnerlichung von Sprache beschreibt, und Theorien zum Arbeitsgedächtnis, besonders die von Baddeley und seinem Konstrukt der phonologischer Schleife (phonological loop). Erstere kann sehr gut zur Gestalttherapie in Bezug gesetzt werden (besonders die Betonung der dialogischen Qualität von innerer Sprache, vgl. auch Staemmler, 2012, Kap. 6), während mir bei der zweiten höchstens einleuchtet, dass das innere Wiederholen einen Telefonnummer dazu führt, dass ich sie besser behalte – ein Anwendungsaspekt der phonologischen Schleife, der mich nur über Umwege zu Ideen der Gestalttherapie zu führen vermag (z.B. die Frage, mit welchen Mikroschritten kommt der Quatschi in den Menschen?). Natürlich hat letztere Theorie auch einiges über die Fähigkeit zu planen etc. zu sagen. Augenscheinlich scheinen sich beide Theorien ungeachtet ihrer konkreten Anwendungsaspekte und abzüglich einiger Kritikpunkte mehr oder weniger bewährt zu haben.
Am schwierigsten ist die methodologische Erfassung von innerem Sprechen, da es ja nicht von außen erfassbar ist, sondern immer nur von Berichten über das innen Erlebte herrührt. Es gibt mittlerweile alle möglichen Versuche: Fragebögen, auf der Teilnehmende Selbsteinschätzungen vornehmen können (Beispielitem: „In meinem Kopf spreche ich kritisch zu mir selbst“ - „In my head I talk to myself a critical way“), die zwar relativ reliabel aber – wenig verwunderlich – nicht sehr valide sind; Zufallsstichprobenziehungen von Erfahrungen zu unterschiedlichen Tageszeiten (z.B. nach einem zufälligen Piepton), die dann, je nach Instrument, auf bestimmte Weise berichtet werden müssen; die Beobachtung von privatem Sprechen (als Proxy für inneres Sprechen), was allerdings nicht unbedingt parallel zu innerem Sprechen verläuft und so der Transfer zumindest in Frage gestellt werden kann; Verhindern von innerem Sprechen und die Messung von Auswirkungen davon auf andere Aufgabenbereiche; Induktion von inneren phonologischem Erleben, z.B. das Beurteilen, ob sich etwas reimt, wobei auch hier der Transfer schwierig wird, da auch das orthographische Erleben zu richtigen Bewertungen führt; Neurobildgebung und neuropsychologische Methoden, bei denen Teilnehmende aufgefordert werden, innerlich zu sprechen und dann gleichzeitig ihreGehirnaktivität gemessen wird.
Und was sagt uns die Forschung basierend auf diesen Methoden, mit all ihren Vor- und Nachteilen, jetzt über unserem Quatschi?
Entwicklungspsychologisch gesprochen entwickelt sich die Fähigkeit, phonologische Informationen im Gedächtnis zu behalten bei Kindern ungefähr im Alter von 18 Monaten und privates Sprechen, meist als Kommentar zu einer gerade ausgeführten Tätigkeit zwischen 2-3 Jahren. Dieses private Sprechen wandert ca. im Alter von 5 Jahren „in den Untergrund“ (S. 935) und wird somit zu innerem Sprechen, bleibt aber oft auch noch bis ins Erwachsenenalter bestehen. Privates Sprechen kommt bei Kindern häufiger vor, wenn noch eine Person anwesend ist, bei innerem Sprechen macht eine weitere Person keinen Unterschied, was auf eine zusätzliche soziale Funktion von privatem Sprechen (nicht jedoch innerem Sprechen) hinweist. Im Alter von 7 Jahren scheinen phonologische Elemente von Wörtern für das Erinnerungsvermögen eine Rolle zu spielen, vorher nicht, ein Ergebnis, das derzeit jedoch wieder in Frage gestellt wird. Allerdings scheinen jüngere Kinder inneres Sprechen nicht spontan zu benutzen. Und wie erleben Kinder inneres Sprechen? Schwer zu sagen, weil Kinder oft wenig Lust haben, über inneres Sprechen zu berichten. Meinungen reichen von „Kinder sprechen innerlich gar nicht (wie Erwachsene)“ bis „imaginäre Gefährten sind unweigerlich mit innerem Sprechen verbunden“.
Und Erwachsene? Die bräuchten den Quatschi eigentlich gar nicht für logische Aufgaben oder sogar verbales Material. Beim inneren Lesen lösen meist nur komplexe Texte Erfahrungen von innerem Sprechen aus. Für die Gestalttherapie höchst interessant sind die Befunde zum Selbstgespräch auf Motivation und Verhalten: Fragen à la „Werde ich das schaffen?“ führten zu besserer Motivation als deklarative Formen „Ich schaffe das!“, Ansprachen in der zweiten Person „Du schaffst das!“ zu besseren als Selbstaussagen in erster Person „Ich schaffe das!“ Das weist auf eine Verinnerlichung von vergangenen Ansprachen durch andere Personen hin (vermeintlich soziale Ursprünge), also die Idee der Introjektion. Es wäre sicher wertvoll, diese Forschungsrichtung genauer anzuschauen, besonders, da ich in der PsycINFO-Datenbank keinerlei Einträge zu „Sprache der Verantwortung“ oder ähnlichem außerhalb des Dunstkreises von theoretischer Psychologie mit Schwerpunkt auf Existentialismus finden konnte. Die o.g. Selbstgesprächeforschung weist jedoch deutlich darauf hin, dass kleine Veränderungen in der Wortwahl und Grammatik große Unterschiede in anderen Phänomenen ausmachen, was die Gestalttherapie ja auch annimmt.
Erwähnt wird außerdem noch der Überschattungseffekt von Sprache auf Gedächtnisleistung. Salopp ausgedrückt besagt dieser, dass meine Erinnerung an eine Szene sich verschlechtert, sobald ich eine Szene mit Worten beschreibe (um genau zu sein, um 4-16%), sprich eine Art „Kontamination des Gedächtnisinhalts“ durch Versprachlichung. Zwar ist das seit Loftus ja schon bekannt, aber so wie in diesem Review beschrieben stelle ich mir die Frage, ob das für die Gestalttherapie heißen könnte, (a) nicht immer alles in Worte fassen zu lassen, (b) dies als wünschenswerten Effekte mehr zu nutzen, oder (c) oder es als normalen Vorgang im immerwährenden Fluss der Awareness einfach anzunehmen. Es kommt wahrscheinlich drauf an.
Besonders interessant für die Gestalttherapie sind die Ergebnisse zu den Sprachinhalten des inneren Sprechens. Hier fällt auf, dass die meisten Forschungsgruppen sich auf die Erforschung von Kontext und Funktionen des inneren Sprechens beschränken, und nur wenig über die Inhalte zu sagen haben. Auf den ersten Blick lesen sich die (wenigen) Befunde jedoch wie eine überwältigende Bestätigungswelle für den Quatschi:
„Verbreitete Inhalte des inneren Sprechens waren an sich selbst adressierte Bewertungen und emotionale Zustände, während mnemonische Funktionen (Erinnerungen daran, etwas zu tun) als weit verbreitetste Funktionen aufgelistet wurden.“ (S. 940, left column)
„Von diesen [vier Faktoren, nämlich: dialogisches innere Sprechen, kondensiertes inneres Sprechen, andere Menschen im inneren Sprechen und evaluatives/motivationales inneres Sprechen] war besonders der evaluative/motivationale weit verbreitet: 82,5% der Antworten verwiesen auf wenigstens einige Erfahrungen mit diesen Charakteristiken. Das dialogische innere Sprechen war fast genau so verbreitet (77,2%) […] Evaluatives inneres Sprechen und die Anwesenheit anderer Menschen im inneren Sprechen standen beide in positivem Zusammenhang mit Trait-Angst und, etwas schwächer, mit Depression. […] [E]valuatives inneres Sprechen, aber keine anderen Formen des inneren Sprechens, sagten geringeres globales Selbstwertgefühl voraus.“ (S. 940, right column, freie Übers. ahc)
Allerdings wird das Bild komplexer, wenn man sich die Details ansieht, auf denen diese Ergebnisse basieren, nämlich meist auf Selbstbewertungsfragebögen. Ungeachtet der Probleme von Fragebögen allgemein scheint zwar klar zu werden, dass eine große Mehrheit Erfahrungen mit dem bewertenden Quatschi hat und auch mit dem, was Perls Topdog-Underdog nennt (wenn ich einmal dialogisches Sprechen als eine Form davon ansehe), allerdings bleibt unklar inwiefern (a) die Teilnehmenden so eine Einschätzung überhaupt genau genug vornehmen können (ich weiß zumindest nicht immer, was/wie ich zu mir spreche) und (b) wie oft am Tag dies passiert. Die genannten 82,5% sind eine Zusammenfassung von verschiedensten Informationen: Es wurde geschaut, wie viele der Teilnehmenden Items der evaluativ/motivational Subskala mit „trifft mit Sicherheit auf mich zu“, „trifft möglicherweise auf mich zu“, und „wenn überhaupt, trifft ein kleines Bisschen auf mich zu“ angekreuzt hatten. Selbst wenn man mal davon absieht, dass „trifft möglicherweise auf mich zu“ auch beinhaltet, das es „möglicherweise nicht“ zutrifft (möglicherweise eben), haben insgesamt nur 34.5% wirklich „trifft mit Sicherheit auf mich zu“ angegeben. In einer Neufassung des Fragebogens (Alderson-Day et al. 2018), wurde die Skala auf sieben Abstufungen (statt vorher sechs) verändert und die Antwortmöglichkeiten bilden nicht mehr das „Zutreffen“ dieses Phänomens ab, sondern die Häufigkeit des Auftretens (von nie bis immer). Hier finden wir zwar auch für evaluatives/motivationales inneres Sprechen den höchsten Mittelwert (29,96, SD=7,28), aber bei einer Höchstausprägung bei 7 Items von 49 ist das weit entfernt von immer; 26% geben an, immer oder sehr oft evaluativ/motivational innerlich zu sprechen, aber es gibt auch 18%, die dies nie oder sehr selten zu tun glauben. Außerdem besteht zumindest bei einem Item dieser Skala eine Vermischung von Inhalt und Folgen („Mein inneres Sprechen führt dazu, dass ich mich niedergeschlagen und depressiv fühle.“ Item 24).
Diese vielen Bedenken haben mich auf die Spur einer anderen Methodik gebracht, die ebenfalls erwähnt, aber nicht besonders ausgeführt wird, die einer sehr phänomenologischen Methodik von Russell Hurlburt, genannt Descriptive Experience Sampling (DES; deskriptives Erfahrungsstichprobenziehen). Diese Methodik versucht, alle Vorannahmen über inneres Sprechen auszuklammern und rein phänomenologisch zu erfragen, was sich einer Person kurz (1 Sekunde) vor einem während eines normalen Tages platzierten und zufällig ausgelösten Piepton gerade gewahr gewesen ist. Sechs Erfahrungen pro Tag werden jeden Abend per Interview und anhand der Aufschriebe der Versuchspersonen näher beleuchtet, wobei darauf geachtet wird, so nah wie möglich am Phänomen zu bleiben. Ähnlich wie bei Ausbildungsseminaren zur Gestalttherapie stellten die Forscher fest, dass die Versuchspersonen anfänglich sehr stark interpretierten und erst nach einigen Rückmeldungen im Interview phänomenologisch orientiert beschreiben lernten. Diese sogenannte „iterative Verbesserung“ lässt einmalige Untersuchungsansätze noch zweifelhafter erscheinen. Hurlburt und seine Kollegen haben eine Reihe von sehr interessanten Ergebnissen zutage gebracht, die ich aufgrund der vielen Bezüge zu dem, was wir in der Gestalttherapie annehmen, in einem weiteren Häppchen noch aufbereiten werde. Zum inneren Sprechen sei berichtet, dass nur 20-25% der Zufallsstichproben inneres Sprechen zutage brachten und Hulrburts
Ergebnisse somit der oft postulierten Annahme, Menschen würden permanent zu sich sprechen, entgegensteht. Die Art und Weise wie Menschen innerlich sprechen unterscheidet sich auch stark, ist also sehr idiosynkratisch, und während es tatsächlich wenige Menschen gibt, die permanent mit sich zu sprechen scheinen, gibt es ebenso Menschen, die gar nicht innerlich sprechen. Es besteht also offensichtlich eine gewisse Überschätzung des Quatschi.
Von der Qualität des Sprechens her, hören sich die meisten Menschen in ihrer eigenen Stimme mit dem ihr typischen Rhythmus, der ihnen typischen Geschwindigkeit und Tonlage wie in ihrer externen Stimme; das Sprechen findet typischerweise in ganzen Sätzen statt und innere Sprecher benutzen dieselben Wörter wie beim externen Sprechen, dieselben emotionalen Färbungen und erleben sich eher als aktiv das Sprechen kreierend (vs. passiv hörend). Inneres Sprechen scheint sich zu unterscheiden von innerem Hören, nicht-symbolischen Denken, sensorischem Gewahrsein (oder in Gestaltsprache, der äußeren Zone), und Denken als rein kognitivem Prozess (S. 941).
Eine Frage, die noch im Raum steht ist inwieweit inneres Spreche und externes Sprechen verbunden sind und wenn wie. Während oft starke Ähnlichkeit in den beiden Sprechebenen berichtet wird, gibt es auch viele Unterschiede. Manche Forscher sprechen davon, dass inneres Sprechen eine verarmte Version des externen Sprechens ist, andere davon, dass inneres Sprechen lediglich die Funktion habe, Fehler in der Produktion von externem Sprechen zu überwachen. Interessante Studien, die z.B. finden, dass Zungenbrecher bei innerem Sprechen nicht passieren basieren jedoch ausschließlich auf Berichten der Versuchspersonen. Hurlburt wiederum findet, das das Zeitempfinden beim inneren Sprechen nicht den herkömmlichen Regeln der Physik entspricht, sondern viele innere Sprecher gefühlt gleichschnell sprechen wie sonst beim externen Sprechen, das aber in Bruchteilen von Sekunden passiert. Eine Unmöglichkeit, die auf große Unterschiede hinweist.
Die Ergebnisse zu innerem Sprechen und Gehirn hier zu referieren, gehen über diese Häppchen leider hinaus. Bisher gibt es viele sich widersprechende Befunde, die bisher zu keiner Bevorzugung eines bestimmten Modells geführt hat, was auch an der Komplexität der Materie liegt. Die sensumotorische Aktivität (zum Bewegen der notwendigen Körperteile zum externen Sprechen), die auch bei innerem Sprechen vorkommt wird oft mit einem sog. somatosensory forward model erklärt. Darin werden sensumotorische Aktivitäten top-down aktiviert, also vorweggenommen, und basieren nicht auf tatsächlich stattfinden sensumotorischen Aktivitäten, die wiederum zu solchen Signalen führen würden. Größtes Problem ist jedoch die ökologische Validität von solchen Studien, da die bisher vorhandenen Setups von fMRI-Scannern doch starke Beeinträchtigungen mit sich bringen.
Mit Spracherfahrungslänge scheint auch die Häufigkeit von innerem Sprechen einher zu gehen. Lerner einer Zweitsprache sprechen innerlich erst mit fortschreitendem Lernniveau auf der neuen Sprache und Menschen mit geringer Lesekompetenz benutzen, ganz im Sinne von Vygotsky, eher privates Sprechen denn inneres Sprechen. Auch blinde Menschen zeigen häufiger privates Sprechen (= Zeichensprache ausschließlich für private Nutzung) als Sprechende, wobei es noch nicht genügend phänomenologische Studien mit Blinden zu dem Thema gibt.
Weitere Themen werden noch in dem Review angeschnitten (z.B., die Beziehung zwischen innerem Sprechen und in Gedanken abschweifen, inneres Sprechen in atypischen Populationen wie z.B. die Abwesenheit von innerem Sprechen bei Störungen des Autistischen Spektrums, Versuch einer ersten Integration in ein noch sehr abstraktes Multikomponentenmodell und die Diskussion, ob inneres Sprechen überhaupt notwendig wäre), die sich aber immer weiter vom Quatschi entfernen. In ihrer Schlussfolgerung sind zwei Aussagen der Autoren hervorzuheben: einmal, dass das Phänomen des inneren Sprechens auch weiterhin paradox ist, und dass es eine große interindividuelle Variabilität des Phänomens gibt. Persönlich glaube ich derzeit, dass die o.g. Ergebnisse, die Häufigkeit des Quatschis durchaus in Frage stellen, was aber nicht bedeutet, dass er weniger nervtötend sein muss oder gar ausgedient hätte. Vielmehr wäre es spannend herauszufinden, in welchen anderen Modalitäten außer Sprache er vorkommen könnte. Bewerten und Abwerten muss ja nicht zwingend über Sprache passieren, sondern kann schon mit einem inneren Seufzer, einem Blick, einer Bewegung, einer diffusen emotionalen Reaktion etc. Einfluss nehmen. Gleichzeitig ist auch hier eine phänomenologische Grundhaltung wichtig, dass ich eben nicht schon an einen Quatschi einer bestimmten Form glaube (und ihn dann auch finde), sondern sich bestimmte Phänomene mit hoher Glaubhaftigkeit zeigen und ich sie dann Quatschi im Sinne eines nervtötenden Abwerters nennen kann. Das Eintreten in einen immerwährenden Überprüfungsprozess unserer Vorannahmen ist auch für die Gestalttherapie wichtig und kann m. E. nicht nur theorieimmanent vollzogen werden. Natürlich bleibt der Klient bei uns Hegemon seiner Interpretationen und demnach ist es im Gegensatz zur Grundlagenforschung weniger wichtig, ob das, was er interpretiert, nun wirklich seiner täglichen Erfahrung entspricht (die Tatsache, dass die Klientin an eine bestimmte Interpretation glaubt hat ja an sich schon Einfluss), gleichzeitig ist es für mich als geschulte Therapeutin doch auch wichtig einschätzen zu können, wie solche Selbstüberzeugungen zustande kommen und in welchem Verhältnis sie zu anderen Interpretationen und Befunden stehen. Und hier muss ich evtl. noch mehr als sonst die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass einige Menschen eben gar nicht innerlich sprechen und dementsprechend möglicherweise auch nicht in gleicher Weise vom Quatschi heimgesucht werden.
Basierend auf:
Alderson-Day, B., & Fernyhough, C. (2015). Inner speech: Development, cognitive runctions, phenomenology, and neurobiology. Psychological Bulletin, 141(5), 931–965. https://doi.org/10.1037/bul0000021
Zitierte Literatur:
Staemmler, F.-M. (2012). Empathy in psychotherapy: How therapists and clients understand each other. New York: Springer.
... link (0 Kommentare) ... comment
Psychische Störungen als Fehlanpassung an Lebensbedingungen
ahc, 11:00h
[Krümel]
Sogenannte “Fehlanpassungskrankheiten” (“mismatch diseases”) sind “definiert als Krankheiten, die daher entstehen, dass unsere steinzeitlichen Körper schlecht oder inadäquat an bestimmte moderne Verhaltensweisen und Bedingungen angepasst sind“ (Kap. 7, freie Übers. ahc).
Nach dem Evolutionsbiologen David Lieberman aus Harvard sind viele Fehlanpassungskrankheiten psychische Störungen, z.B.
Alzheimer
Chronisches Erschöpfungssyndrom
Depression
Essstörungen
Fibromyalgie
Bluthochdruck
Zwangsstörungen
und möglicherweise viele mehr (Tab. 3).
Liebermans Ausführungen passen gut zu der Idee der organismischen Selbst-regulation in einem Organismus/Umgebung-Feld. Der Autor führt viele Beispiele an, wie unsere evolutionsentwickelten Körper plötzlich in Konflikt geraten mit dem modernen Leben („steinzeitliche Körper in einer post-steinzeitlichen Welt“), u.a. bei Themen wie Krebsentstehung, in Schuhen vs. barfuß laufen, Nichtnutzung unserer Fähigkeiten, Übergewicht, ausufernde Hygiene („nur weil wir mit außergewöhnlicher Sauberkeit und Komfort leben können heißt das nicht, dass dies auch gut für uns sei“), Diabetes, Kurzsichtigkeit, etc.
Ein Beispiel zu den Auswirkungen des Sitzens (Kap. 12):
„Wenn Du in einem Standardstuhl sitzt, sind Deine Hüften und Knie rechtwinklig geknickt, eine Position, die deinen Hüftbeugemuskel permanent verkürzen kann. Wenn Du dann stehst, sind Deine verkürzten Hüftbeuger angespannt, so dass sie Dein Becken nach vorn neigen und so zu einer übertriebenen Lendenwirbelkurve führt. Der hintere Oberschenkelmuskel muss sich dann zusammenziehen, um dieser Krümmung entgegenzuwirken, was das Becken nach hinten neigt, was wiederum zu einer flachen Rückenhaltung führt und die Schultern nach vorn krümmt. Glücklicherweise erhöht Dehnen die Muskellänge und Muskelflexibilität effektiv.”
Eine Schlussfolgerung ist: „Jäger-und-Sammler benutzen ihre Rücken moderat – weder so intensiv wie Bauern, noch so minimal wie sitzende Büroarbeiter.“
Ein weiteres faszinierendes Ergebnis (zumindest für mich) betrifft das schmerzhafte Durchbrechen von Weisheitszähnen, das gemäß den Ausführungen des Autors auf zu wenig Kauen im Kindesalter zurückzuführen ist (was evtl. zu der Entwicklung von kleineren Kiefern führe, die nicht groß genug für Weisheitszähne seien). Noch ein weiteres interessantes Ergebnis ist, dass die Knochenstärke beim Menschen anscheinend nach dem Motto „keine Beanspruchung, kein Zugewinn“ bis zum 20.-25. Lebensjahr festgelegt ist (“danach kannst Du wenig machen, um Deine Knochen größer zu machen, und bald danach beginnt dein Skelett für den Rest Deines Lebens an Knochenmasse zu verlieren“).
Original:
Lieberman, D. (2013). The story of the human body: Evolution, health, and disease. New York: Pantheon Books.
Auf Deutsch:
Lieberman, D. (2015). Unser Körper - Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Frankfurt a. M.: Fischer.
Sogenannte “Fehlanpassungskrankheiten” (“mismatch diseases”) sind “definiert als Krankheiten, die daher entstehen, dass unsere steinzeitlichen Körper schlecht oder inadäquat an bestimmte moderne Verhaltensweisen und Bedingungen angepasst sind“ (Kap. 7, freie Übers. ahc).
Nach dem Evolutionsbiologen David Lieberman aus Harvard sind viele Fehlanpassungskrankheiten psychische Störungen, z.B.
Alzheimer
Chronisches Erschöpfungssyndrom
Depression
Essstörungen
Fibromyalgie
Bluthochdruck
Zwangsstörungen
und möglicherweise viele mehr (Tab. 3).
Liebermans Ausführungen passen gut zu der Idee der organismischen Selbst-regulation in einem Organismus/Umgebung-Feld. Der Autor führt viele Beispiele an, wie unsere evolutionsentwickelten Körper plötzlich in Konflikt geraten mit dem modernen Leben („steinzeitliche Körper in einer post-steinzeitlichen Welt“), u.a. bei Themen wie Krebsentstehung, in Schuhen vs. barfuß laufen, Nichtnutzung unserer Fähigkeiten, Übergewicht, ausufernde Hygiene („nur weil wir mit außergewöhnlicher Sauberkeit und Komfort leben können heißt das nicht, dass dies auch gut für uns sei“), Diabetes, Kurzsichtigkeit, etc.
Ein Beispiel zu den Auswirkungen des Sitzens (Kap. 12):
„Wenn Du in einem Standardstuhl sitzt, sind Deine Hüften und Knie rechtwinklig geknickt, eine Position, die deinen Hüftbeugemuskel permanent verkürzen kann. Wenn Du dann stehst, sind Deine verkürzten Hüftbeuger angespannt, so dass sie Dein Becken nach vorn neigen und so zu einer übertriebenen Lendenwirbelkurve führt. Der hintere Oberschenkelmuskel muss sich dann zusammenziehen, um dieser Krümmung entgegenzuwirken, was das Becken nach hinten neigt, was wiederum zu einer flachen Rückenhaltung führt und die Schultern nach vorn krümmt. Glücklicherweise erhöht Dehnen die Muskellänge und Muskelflexibilität effektiv.”
Eine Schlussfolgerung ist: „Jäger-und-Sammler benutzen ihre Rücken moderat – weder so intensiv wie Bauern, noch so minimal wie sitzende Büroarbeiter.“
Ein weiteres faszinierendes Ergebnis (zumindest für mich) betrifft das schmerzhafte Durchbrechen von Weisheitszähnen, das gemäß den Ausführungen des Autors auf zu wenig Kauen im Kindesalter zurückzuführen ist (was evtl. zu der Entwicklung von kleineren Kiefern führe, die nicht groß genug für Weisheitszähne seien). Noch ein weiteres interessantes Ergebnis ist, dass die Knochenstärke beim Menschen anscheinend nach dem Motto „keine Beanspruchung, kein Zugewinn“ bis zum 20.-25. Lebensjahr festgelegt ist (“danach kannst Du wenig machen, um Deine Knochen größer zu machen, und bald danach beginnt dein Skelett für den Rest Deines Lebens an Knochenmasse zu verlieren“).
Original:
Lieberman, D. (2013). The story of the human body: Evolution, health, and disease. New York: Pantheon Books.
Auf Deutsch:
Lieberman, D. (2015). Unser Körper - Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Frankfurt a. M.: Fischer.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 25. Juni 2019
Sensorisches Gewahrsein möglicherweise verlernt
ahc, 10:55h
„Die Familie spielt ein informelles Spiel während des Abendessens. Es ist Weihnachtszeit und Prunkstück ist ein kerzenbeleuchtetes Weihnachtskarussell [...]. Das Spiel ist eine Version von Ich-sehe-was-was-Du-nicht-siehst. Der achtjährige Peter ist dran; er hat etwas am Karussel entdeckt und der Rest der Familie fragt mit Ja/Nein-Fragen, um zu erraten, was Peter sich ausgesucht hat: Bewegt es sich? Nein. Ist es aus Holz? Ja. Ist es weiß oder teilweise weiß? Ja. Die Kinder lieben dieses Spiel, welches sie sich ausgedacht und über die Jahre immer mehr verfeinert haben. Letztendlich gibt die Familie auf und will von Peter wissen, was er sich ausgesucht hat; er sagt es seinen die Bälle, die auf den Zaunpfählen rund um die Fläche des Karussels steckten. ‘Peter! Das ist gar kein Weiß auf diesen Bällen! Sie sind komplett rot!’ Und das sind sie, objektiv gesehen, einheitlich rot angemalt, kein Fleck weißer Farbe auf ihnen. Die Familie unterhält sich unbeschwert darüber, wieviel einfacher es gewesen wäre, hätte Peter die korrekte Antwort auf die Frage seines Bruders ‘Ist es weiß oder teilweise weiß?’ gegeben. Peter steigt nicht in die Unterhaltung ein.
Ein sorgfältigerer Blick auf die roten Bälle zeigt jedoch, dass auf jedem die Reflektion von zwei angrenzenden Kerzenflammen zu sehen ist, zwei kleine Punkte von erlebtem Weiß auf den, objektiv gesehen, einheitlich roten Bällen. Diese Punkte sind winzig und zählen für niemanden zu ‘weiß’ außer für Peter, der möglicherweise sensorisch mehr gewahr ist als irgendjemand anderes aus der Familie. Aber, in der Tat, sind sie, wenn man genau hinschaut, im Erleben weiß. Peter wurde (natürlich auf sehr milde Weise) bestraft für seine sensorische Sensitivität, und er hat nicht das Selbstvertrauen, sich selbst zu verteidigen.
Wir spekulieren, dass innere Erfahrungen (sensorisches Gewahrsein, inneres Sprechen, inneres Sehen, etc.) Fähigkeiten sind, die während der Entwicklung angeeignet werden. Peter hat seine kleine Lektion gelernt: dass sensorisches Gewahrsein nicht zählt; dass du bestraft wirst, wenn du über sensorisches Gewahrsein sprichst. Wir spekulieren, dass eine lange Reihe von solchen Ereignissen – in der Familie, im Klassenzimmer und letzten Endes auch am Arbeitsplatz – dazu führt, das Peters sensorisches Gewahrsein verkümmert oder in den Untergrund geht: er wird nicht darüber sprechen, nicht mal zu sich selbst; er wird verlegen, wenn er irgendwie dazu gedrängt wird, darüber zu reden [...]; er wird abstreiten, dass er es [dieses Gewahrsein; ahc] hat; er wird sich in seinen Narrativen über sich selbst nicht wirklich mit der Tatsache identifizieren, dass er es hat.” (S. 248f; frei übersetzt von ahc)
Direktzitat aus:
Hurlburt, R. T., Heavey, C. L., & Bensaheb, A. (2009). Sensory awareness. Journal of Consciousness Studies, 16(10-12), 231-251.
Ein sorgfältigerer Blick auf die roten Bälle zeigt jedoch, dass auf jedem die Reflektion von zwei angrenzenden Kerzenflammen zu sehen ist, zwei kleine Punkte von erlebtem Weiß auf den, objektiv gesehen, einheitlich roten Bällen. Diese Punkte sind winzig und zählen für niemanden zu ‘weiß’ außer für Peter, der möglicherweise sensorisch mehr gewahr ist als irgendjemand anderes aus der Familie. Aber, in der Tat, sind sie, wenn man genau hinschaut, im Erleben weiß. Peter wurde (natürlich auf sehr milde Weise) bestraft für seine sensorische Sensitivität, und er hat nicht das Selbstvertrauen, sich selbst zu verteidigen.
Wir spekulieren, dass innere Erfahrungen (sensorisches Gewahrsein, inneres Sprechen, inneres Sehen, etc.) Fähigkeiten sind, die während der Entwicklung angeeignet werden. Peter hat seine kleine Lektion gelernt: dass sensorisches Gewahrsein nicht zählt; dass du bestraft wirst, wenn du über sensorisches Gewahrsein sprichst. Wir spekulieren, dass eine lange Reihe von solchen Ereignissen – in der Familie, im Klassenzimmer und letzten Endes auch am Arbeitsplatz – dazu führt, das Peters sensorisches Gewahrsein verkümmert oder in den Untergrund geht: er wird nicht darüber sprechen, nicht mal zu sich selbst; er wird verlegen, wenn er irgendwie dazu gedrängt wird, darüber zu reden [...]; er wird abstreiten, dass er es [dieses Gewahrsein; ahc] hat; er wird sich in seinen Narrativen über sich selbst nicht wirklich mit der Tatsache identifizieren, dass er es hat.” (S. 248f; frei übersetzt von ahc)
Direktzitat aus:
Hurlburt, R. T., Heavey, C. L., & Bensaheb, A. (2009). Sensory awareness. Journal of Consciousness Studies, 16(10-12), 231-251.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 24. Juni 2019
Ist Bubers Ich-Du wesentlicher?
ahc, 09:55h
[Krümel]
“Vielleicht ist, wie Buber es vorschlägt, eine Ich-Du Beziehung eine wesentlichere Art, um einen Zugang dazu zu bekommen, wie die Dinge sind, als eine Ich-Es Beziehung. Ohnehin gibt es, wie ich vorschlage, keine guten Gründe dafür anzunehmen, dass der unpersönliche, objektive Standpunkt der einzige ist, durch den Dinge adequat enthüllt werden können." (S. 243, freie Übers. ahc)
Antwort von Philosophieprofessor Matthew Ratcliffe (Universität York) auf das Problem der argumentativen Zirkularität, die bei der Annahme entsteht, dass ein theoretischer Standpunkt der Welt Vorrang vor einem erfahrungsbasierten haben sollte:
"Warum sollten bestimmte kognitive Prozesse Vorrang haben?
Weil die Welt so und so ist.
Warum glaubst Du ist die Welt so?
Weil die Prozesse sie so enthüllen."
(ebd., freie Übers. ahc)
Ratcliffe, M. (2007). Rethinking commonsense psychology - A critique of folk psychology, theory of mind and simulation. New York: Palgrave Macmillan.
Ratcliffe hat auch eine Abandlung über die Phänomenologie von Depressionen geschrieben, in der er behauptet, dass "trotz des riesigen Forschungsumfangs zu Ursachen und Behandlung von Depression, die Erfahrung von Depressionen bisher kaum verstanden" worden ist. In seinem Buch beschreibt er eine neue phänomenologische Sicht:
Ratcliffe, M. (2014). Experiences of depression: A study in phenomenology. Oxford: Oxford University Press. (Kapitel 1 hier online einsehbar).
Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber diese Sicht wird für Gestalttherapeutinnen wohl nicht so neu sein.
“Vielleicht ist, wie Buber es vorschlägt, eine Ich-Du Beziehung eine wesentlichere Art, um einen Zugang dazu zu bekommen, wie die Dinge sind, als eine Ich-Es Beziehung. Ohnehin gibt es, wie ich vorschlage, keine guten Gründe dafür anzunehmen, dass der unpersönliche, objektive Standpunkt der einzige ist, durch den Dinge adequat enthüllt werden können." (S. 243, freie Übers. ahc)
Antwort von Philosophieprofessor Matthew Ratcliffe (Universität York) auf das Problem der argumentativen Zirkularität, die bei der Annahme entsteht, dass ein theoretischer Standpunkt der Welt Vorrang vor einem erfahrungsbasierten haben sollte:
"Warum sollten bestimmte kognitive Prozesse Vorrang haben?
Weil die Welt so und so ist.
Warum glaubst Du ist die Welt so?
Weil die Prozesse sie so enthüllen."
(ebd., freie Übers. ahc)
Ratcliffe, M. (2007). Rethinking commonsense psychology - A critique of folk psychology, theory of mind and simulation. New York: Palgrave Macmillan.
Ratcliffe hat auch eine Abandlung über die Phänomenologie von Depressionen geschrieben, in der er behauptet, dass "trotz des riesigen Forschungsumfangs zu Ursachen und Behandlung von Depression, die Erfahrung von Depressionen bisher kaum verstanden" worden ist. In seinem Buch beschreibt er eine neue phänomenologische Sicht:
Ratcliffe, M. (2014). Experiences of depression: A study in phenomenology. Oxford: Oxford University Press. (Kapitel 1 hier online einsehbar).
Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber diese Sicht wird für Gestalttherapeutinnen wohl nicht so neu sein.
... link (0 Kommentare) ... comment
... older stories