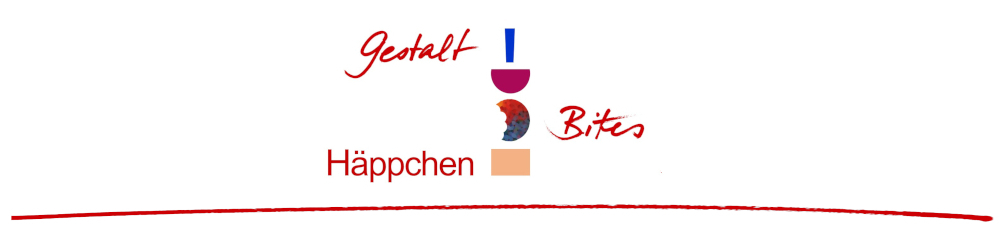Donnerstag, 17. Juni 2021
Ähnliche Repräsentationen von Selbst und Anderen im Gehirn
ahc, 10:39h
?Es ist interessant festzustellen, dass unsere Fähigkeiten, eigene Gedanken und Gedanken anderer Personen zu repräsentieren, eng miteinander verbunden sind und dass sie ähnlichen Ursprungs im Gehirn sind. Die Tatsache dass es eine teilweise Überlappung zwischen der Verarbeitung des Selbst und anderer zu geben scheint, passt sehr gut zum alten Sprichwort ?sich in anderer Leute Schuhe zu stecken??. (S. 532).
Decety, J., & Sommerville, J. A. (2003). Shared representations between self and other: A social cognitive neuroscience view [Geteilte Repräsentationen zwischen Selbst und Anderen: Eine sozialkognitivneurowissenschaftliche Sicht]. TRENDS in Cognitive Sciences, 7 (12), 527-533. https://doi.org/10.1016/j.tics.2003.10.004
Decety, J., & Sommerville, J. A. (2003). Shared representations between self and other: A social cognitive neuroscience view [Geteilte Repräsentationen zwischen Selbst und Anderen: Eine sozialkognitivneurowissenschaftliche Sicht]. TRENDS in Cognitive Sciences, 7 (12), 527-533. https://doi.org/10.1016/j.tics.2003.10.004
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 6. Februar 2021
Werden wir bessere Therapeut*innen je mehr Klient*innen wir behandeln?
ahc, 10:50h
[erstere Eintrag nach Corona-Pause]
Und was macht überhaupt eine*n gute*n Therapeut*in aus?
Im Deutschen kennen sicher viele das Sprichwort “Übung macht den Meister.“ Während sich die Idee darin auf den ersten Blick richtig anfühlt, müssen wir bei näherer Betrachtung wahrscheinlich zugeben, dass nur korrekte Übung den sprichwörtlichen Meister macht. In ihrem Herausgeberwerk „Der Exzellenzkreislauf“ (The cycle of excellence) machen sich die Autoren auf den mühsamen Weg herauszufinden, was eine*n gute*n Therapeut*in ausmacht und wie jemand seine Psychotherapiefähigkeiten verbessern kann.
Sie benutzen das Konzept der „reflektierten Übung“ (deliberate practice) um das Phänomen zu erklären, wonach die meisten Therapeut*innen nach anfänglichen Verbesserungen im Laufe ihrer Karriereentwicklung auf einem mittlerem Fähigkeitsniveau stehen bleiben: Es scheinen nur solche Therapeut*innen im Laufe ihres Arbeitsalltags besser und besser zu werden, die viele Stunden in reflektierte Übung investieren – genau genommen 4,5 mal mehr Stunden als weniger effektive Therapeut*innen (S. 9). Wir lernen ebenfalls, dass sich im US-System postgraduierte Studierende hoch motiviert ins Psychotherapiestudium stürzen, jedoch nach ihrem Eintritt in die eigenständige Arbeit nur noch sehr diffuse Weiterentwicklungsmaßnahmen ergreifen und reflektiertes Üben (z.B. in Form von weiterführender Supervision, zusätzlichem Training in schwachen Bereichen oder selbstverordnete Evaluationsverfahren der eigenen Leistung durch Klienten) weniger herausfordernd und im Vergleich zu ihrem Studium auch weniger ansprechend finden (S. 13). Allerdings zeigt die Literatur, dass hoch-effektive Therpeut*innen sich gerade durch „Ausdauer und Leidenschaft im Hinblick auf Langzeitziele“ (Duckworth et al. zit. nach Rousmaniere et al. 2017, S. 13) auszeichnen.
Was macht also eine*n gute*n Therapeut*in aus? Oder, im Forschungsjargon formuliert: Welche Therapeut*innenvariablen sagen Psychotherapiewirksamkeit am besten voraus?
Die Liste solcher Eigenschaften und Verhaltensweisen von effektiven Therapeu*tinnen ist lang: die Fähigkeit, eine therapeutische Beziehung mit unterschiedlichsten Klient*innen aufzubauen, und unterstützende interpersonelle Fähigkeiten, die besonders bei „schwierigen“ Klient*innen sichtbar werden, stechen hierbei besonders heraus. Aber was sind denn „unterstützende interpersonelle Fähigkeiten?“ Darunter fallen neben den Klassikern wie Wärme und Empathie, emotionale Ausdrucksfähigkeit, hoffnungsvoller Optimismus, Problemfokussierung und Beziehungsfähigkeit interessanterweise genauso Überzeugungskraft, eine kohärente Behandlungsstrategie, professioneller Selbstzweifel und reflektiertes Üben (Wampold in Rousmaniere et al., S. 56ff). Das heißt., es haben gerade solche Therapeut*innen gute Therapieergebnisse, die überzeugt von ihrer Behandlungsmethode sind, die fokussiert auf das Problem der Klient*innen bleiben und die auch weiterhin ein bestimmtes Maß and Selbstzweifel daran mitbringen, ob ihre Behandlungsweise der*dem Klient*in auch dienlich ist. Die theoretische Orientierung ist dabei per se nicht ausschlaggebend, ebenso wenig wie das Alter, Geschlecht oder Beruf des*der Therapeut*in oder auch Manualtreue etc.
Hier ist kein Platz um alle Ratschläge des Kreislaufs aufzuführen, aber um die Eingangsfragen mit Hilfe der Hauptideen des Buchs zu beantworten: Nein, mehr Klient*innenstunden machen uns nicht automatisch zu besseren Therapeut*innen. Am wichtigsten ist, eine Methode zu finden, von der wir leidenschaftlich überzeugt sind, dabei neugierig auf andere Behandlungsmethoden zu bleiben und sich auf eine lebenslange professionelle Weiterentwicklungsnotwendigkeit (reflektiertes Üben) einzustellen, die wir auch als Modell gegenüber unseren Student*innen vorleben sollten. Und während reflektiertes Üben dabei auch nicht den perfekten Meister macht, bringt es uns doch näher ans Ziel unsere*n Klient*innen so gut wie möglich dienlich zu sein. Im Moment ist das die beste Option die wir als Therapeut*innen wählen können.
Rousmaniere, T., Goodyear, R. K., Miller, S. D., & Wampold, B. E. (Eds.) (2017). The cycle of excellence [Der Exzellenzkreislauf]. Wiley Blackwell.
Und was macht überhaupt eine*n gute*n Therapeut*in aus?
Im Deutschen kennen sicher viele das Sprichwort “Übung macht den Meister.“ Während sich die Idee darin auf den ersten Blick richtig anfühlt, müssen wir bei näherer Betrachtung wahrscheinlich zugeben, dass nur korrekte Übung den sprichwörtlichen Meister macht. In ihrem Herausgeberwerk „Der Exzellenzkreislauf“ (The cycle of excellence) machen sich die Autoren auf den mühsamen Weg herauszufinden, was eine*n gute*n Therapeut*in ausmacht und wie jemand seine Psychotherapiefähigkeiten verbessern kann.
Sie benutzen das Konzept der „reflektierten Übung“ (deliberate practice) um das Phänomen zu erklären, wonach die meisten Therapeut*innen nach anfänglichen Verbesserungen im Laufe ihrer Karriereentwicklung auf einem mittlerem Fähigkeitsniveau stehen bleiben: Es scheinen nur solche Therapeut*innen im Laufe ihres Arbeitsalltags besser und besser zu werden, die viele Stunden in reflektierte Übung investieren – genau genommen 4,5 mal mehr Stunden als weniger effektive Therapeut*innen (S. 9). Wir lernen ebenfalls, dass sich im US-System postgraduierte Studierende hoch motiviert ins Psychotherapiestudium stürzen, jedoch nach ihrem Eintritt in die eigenständige Arbeit nur noch sehr diffuse Weiterentwicklungsmaßnahmen ergreifen und reflektiertes Üben (z.B. in Form von weiterführender Supervision, zusätzlichem Training in schwachen Bereichen oder selbstverordnete Evaluationsverfahren der eigenen Leistung durch Klienten) weniger herausfordernd und im Vergleich zu ihrem Studium auch weniger ansprechend finden (S. 13). Allerdings zeigt die Literatur, dass hoch-effektive Therpeut*innen sich gerade durch „Ausdauer und Leidenschaft im Hinblick auf Langzeitziele“ (Duckworth et al. zit. nach Rousmaniere et al. 2017, S. 13) auszeichnen.
Was macht also eine*n gute*n Therapeut*in aus? Oder, im Forschungsjargon formuliert: Welche Therapeut*innenvariablen sagen Psychotherapiewirksamkeit am besten voraus?
Die Liste solcher Eigenschaften und Verhaltensweisen von effektiven Therapeu*tinnen ist lang: die Fähigkeit, eine therapeutische Beziehung mit unterschiedlichsten Klient*innen aufzubauen, und unterstützende interpersonelle Fähigkeiten, die besonders bei „schwierigen“ Klient*innen sichtbar werden, stechen hierbei besonders heraus. Aber was sind denn „unterstützende interpersonelle Fähigkeiten?“ Darunter fallen neben den Klassikern wie Wärme und Empathie, emotionale Ausdrucksfähigkeit, hoffnungsvoller Optimismus, Problemfokussierung und Beziehungsfähigkeit interessanterweise genauso Überzeugungskraft, eine kohärente Behandlungsstrategie, professioneller Selbstzweifel und reflektiertes Üben (Wampold in Rousmaniere et al., S. 56ff). Das heißt., es haben gerade solche Therapeut*innen gute Therapieergebnisse, die überzeugt von ihrer Behandlungsmethode sind, die fokussiert auf das Problem der Klient*innen bleiben und die auch weiterhin ein bestimmtes Maß and Selbstzweifel daran mitbringen, ob ihre Behandlungsweise der*dem Klient*in auch dienlich ist. Die theoretische Orientierung ist dabei per se nicht ausschlaggebend, ebenso wenig wie das Alter, Geschlecht oder Beruf des*der Therapeut*in oder auch Manualtreue etc.
Hier ist kein Platz um alle Ratschläge des Kreislaufs aufzuführen, aber um die Eingangsfragen mit Hilfe der Hauptideen des Buchs zu beantworten: Nein, mehr Klient*innenstunden machen uns nicht automatisch zu besseren Therapeut*innen. Am wichtigsten ist, eine Methode zu finden, von der wir leidenschaftlich überzeugt sind, dabei neugierig auf andere Behandlungsmethoden zu bleiben und sich auf eine lebenslange professionelle Weiterentwicklungsnotwendigkeit (reflektiertes Üben) einzustellen, die wir auch als Modell gegenüber unseren Student*innen vorleben sollten. Und während reflektiertes Üben dabei auch nicht den perfekten Meister macht, bringt es uns doch näher ans Ziel unsere*n Klient*innen so gut wie möglich dienlich zu sein. Im Moment ist das die beste Option die wir als Therapeut*innen wählen können.
Rousmaniere, T., Goodyear, R. K., Miller, S. D., & Wampold, B. E. (Eds.) (2017). The cycle of excellence [Der Exzellenzkreislauf]. Wiley Blackwell.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 15. Januar 2020
Die “Welt-wie-sie-wirklich-ist“
ahc, 12:28h
„[…] ich glaube, dass ein explizit anthropomorpher Ansatz unbefriedigend und es wert ist, neu überdacht zu werden. Sollten Körper und Umwelt Bestandteile von dem sein, was wir Geist [engl. mind] nennen, dann wird es sehr schwer zu sehen, wie andere Tiere, wie andere Körperarten, die in anderen Umwelten leben, in einer Weise ‚denken‘ würden [i. S. von ‚to mind‘ als Verb], die auch nur annähernd unserer eigenen entspräche, um die Attribution von menschenartigen psychischen Zuständen zu erlauben. Falls die Ideen zur Umwelt, Gibson’s ökologische Theorie und verkörperte sensorimotorische Theorien etwas für sich haben, müssen wir am Ende akzeptieren, dass wir ‚die Welt-wie-sie-wirklich-ist’ nicht sehen; wir sehen sie nur insofern sie unsere menschlichen Bedürfnisse und Körperlichen Fähigkeiten widerspiegelt.“ (S. 223, freie Übers. ahc)
Aus:
Barrett, L. (2011). Beyond the brain: How body and environment shape animal and human minds. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Aus:
Barrett, L. (2011). Beyond the brain: How body and environment shape animal and human minds. Princeton, NJ: Princeton University Press.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 31. Oktober 2019
Wo wissenschaftlicher Diskurs wie Therapie klingt
ahc, 07:18h
[Krümel]
In ihrem Buch "Eine Leidenschaft für Spezifität: Innere Erfahrung in Literatur und Wissenschaft konfrontieren" (orig. „A passion for specificity: Confronting inner experience in literature and science“) verwenden Caracciolo und Hurlburt (2016) eine Gesprächsmethode, die versucht (1) die Merkmale geistiger Erfahrung (beim Lesen von Literatur) zu beschreiben und (2) zu bestimmen, wo sich Erfahrungen, die in der Literatur vermittelt werden, und Erfahrungen, die von wissenschaftlichen Methoden erfasst werden, begegnen könnten.
So schließen sie ihren Diskurs:
"Anstelle einer Schlussfolgerung
[....]
Das war’s? Du hörst hier einfach auf?
Hier, wie in den meisten Beziehungen, gibt es kein wirkliches Ende. Wir haben uns dem Dialog geöffnet, den Phänomenen unsere kompromisslose Aufmerksamkeit geschenkt und versucht, unsere Vorannahmen loszulassen, und wir haben jetzt innegehalten, um zu teilen, was geschehen ist. Es liegt an Ihnen, lieber Leser, zu bestimmen, inwieweit unsere Kämpfe mit Ihrer Erfahrung Resonanz erzeugen." (S. 316, Übers. ahc)
Ich fand dies eine überraschende Schlussfolgerung, weil dieser Satz auch genauso von einem Gestalttherapeuten oder Gestalttherapeutin hätte stammen können. Mit Laskowska (2017, S. 96) gesprochen würde ich höchstens noch hinzufügen: und "was davon Sie in Ihrem Alltag umsetzen möchten."
Caracciolo, M., & Hurlburt, R. T. (2016). A passion for specificity: Confronting inner experience in literature and science. Columbus: The Ohio State University Press.
Laskowska, B. (2017). Worte finden – Die Nöte einer Gestalttherapeutin [Finding words – A Gestalt therapist’s woes]. Gestalttherapie, 31(2), 75–97.
In ihrem Buch "Eine Leidenschaft für Spezifität: Innere Erfahrung in Literatur und Wissenschaft konfrontieren" (orig. „A passion for specificity: Confronting inner experience in literature and science“) verwenden Caracciolo und Hurlburt (2016) eine Gesprächsmethode, die versucht (1) die Merkmale geistiger Erfahrung (beim Lesen von Literatur) zu beschreiben und (2) zu bestimmen, wo sich Erfahrungen, die in der Literatur vermittelt werden, und Erfahrungen, die von wissenschaftlichen Methoden erfasst werden, begegnen könnten.
So schließen sie ihren Diskurs:
"Anstelle einer Schlussfolgerung
[....]
Das war’s? Du hörst hier einfach auf?
Hier, wie in den meisten Beziehungen, gibt es kein wirkliches Ende. Wir haben uns dem Dialog geöffnet, den Phänomenen unsere kompromisslose Aufmerksamkeit geschenkt und versucht, unsere Vorannahmen loszulassen, und wir haben jetzt innegehalten, um zu teilen, was geschehen ist. Es liegt an Ihnen, lieber Leser, zu bestimmen, inwieweit unsere Kämpfe mit Ihrer Erfahrung Resonanz erzeugen." (S. 316, Übers. ahc)
Ich fand dies eine überraschende Schlussfolgerung, weil dieser Satz auch genauso von einem Gestalttherapeuten oder Gestalttherapeutin hätte stammen können. Mit Laskowska (2017, S. 96) gesprochen würde ich höchstens noch hinzufügen: und "was davon Sie in Ihrem Alltag umsetzen möchten."
Caracciolo, M., & Hurlburt, R. T. (2016). A passion for specificity: Confronting inner experience in literature and science. Columbus: The Ohio State University Press.
Laskowska, B. (2017). Worte finden – Die Nöte einer Gestalttherapeutin [Finding words – A Gestalt therapist’s woes]. Gestalttherapie, 31(2), 75–97.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 23. August 2019
Unverfügbarkeit
ahc, 00:43h
"Indem wir Spätmodernen [...] auf die Verfügbarmachung von Welt zielen, begegnet uns die Welt stets als 'Aggressionspunkt' oder als Serie von Aggressionspunkten, das heißt von Objekten, die es zu wissen, zu erreichen, zu erobern, zu beherrschen oder zu nutzen gilt, und genau dadurch scheint sich uns das 'Leben', das, was die Erfahrung von Lebendigkeit und von Begegnung ausmacht - das, was Resonanz ermöglicht -, zu entziehen, was wiederum zu Angst Frust, Wut, ja Verzweiflung führt, die sich dann unter anderem in ohnmächtigem politischem Aggressionsverhalten niederschlagen."
Rosa, H. (2019). Unverfügbarkeit. Wien: Residenz Verlag.
Rosa, H. (2019). Unverfügbarkeit. Wien: Residenz Verlag.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 12. Juli 2019
Psychische Störungen als Fehlanpassung an Lebensbedingungen
ahc, 11:00h
[Krümel]
Sogenannte “Fehlanpassungskrankheiten” (“mismatch diseases”) sind “definiert als Krankheiten, die daher entstehen, dass unsere steinzeitlichen Körper schlecht oder inadäquat an bestimmte moderne Verhaltensweisen und Bedingungen angepasst sind“ (Kap. 7, freie Übers. ahc).
Nach dem Evolutionsbiologen David Lieberman aus Harvard sind viele Fehlanpassungskrankheiten psychische Störungen, z.B.
Alzheimer
Chronisches Erschöpfungssyndrom
Depression
Essstörungen
Fibromyalgie
Bluthochdruck
Zwangsstörungen
und möglicherweise viele mehr (Tab. 3).
Liebermans Ausführungen passen gut zu der Idee der organismischen Selbst-regulation in einem Organismus/Umgebung-Feld. Der Autor führt viele Beispiele an, wie unsere evolutionsentwickelten Körper plötzlich in Konflikt geraten mit dem modernen Leben („steinzeitliche Körper in einer post-steinzeitlichen Welt“), u.a. bei Themen wie Krebsentstehung, in Schuhen vs. barfuß laufen, Nichtnutzung unserer Fähigkeiten, Übergewicht, ausufernde Hygiene („nur weil wir mit außergewöhnlicher Sauberkeit und Komfort leben können heißt das nicht, dass dies auch gut für uns sei“), Diabetes, Kurzsichtigkeit, etc.
Ein Beispiel zu den Auswirkungen des Sitzens (Kap. 12):
„Wenn Du in einem Standardstuhl sitzt, sind Deine Hüften und Knie rechtwinklig geknickt, eine Position, die deinen Hüftbeugemuskel permanent verkürzen kann. Wenn Du dann stehst, sind Deine verkürzten Hüftbeuger angespannt, so dass sie Dein Becken nach vorn neigen und so zu einer übertriebenen Lendenwirbelkurve führt. Der hintere Oberschenkelmuskel muss sich dann zusammenziehen, um dieser Krümmung entgegenzuwirken, was das Becken nach hinten neigt, was wiederum zu einer flachen Rückenhaltung führt und die Schultern nach vorn krümmt. Glücklicherweise erhöht Dehnen die Muskellänge und Muskelflexibilität effektiv.”
Eine Schlussfolgerung ist: „Jäger-und-Sammler benutzen ihre Rücken moderat – weder so intensiv wie Bauern, noch so minimal wie sitzende Büroarbeiter.“
Ein weiteres faszinierendes Ergebnis (zumindest für mich) betrifft das schmerzhafte Durchbrechen von Weisheitszähnen, das gemäß den Ausführungen des Autors auf zu wenig Kauen im Kindesalter zurückzuführen ist (was evtl. zu der Entwicklung von kleineren Kiefern führe, die nicht groß genug für Weisheitszähne seien). Noch ein weiteres interessantes Ergebnis ist, dass die Knochenstärke beim Menschen anscheinend nach dem Motto „keine Beanspruchung, kein Zugewinn“ bis zum 20.-25. Lebensjahr festgelegt ist (“danach kannst Du wenig machen, um Deine Knochen größer zu machen, und bald danach beginnt dein Skelett für den Rest Deines Lebens an Knochenmasse zu verlieren“).
Original:
Lieberman, D. (2013). The story of the human body: Evolution, health, and disease. New York: Pantheon Books.
Auf Deutsch:
Lieberman, D. (2015). Unser Körper - Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Frankfurt a. M.: Fischer.
Sogenannte “Fehlanpassungskrankheiten” (“mismatch diseases”) sind “definiert als Krankheiten, die daher entstehen, dass unsere steinzeitlichen Körper schlecht oder inadäquat an bestimmte moderne Verhaltensweisen und Bedingungen angepasst sind“ (Kap. 7, freie Übers. ahc).
Nach dem Evolutionsbiologen David Lieberman aus Harvard sind viele Fehlanpassungskrankheiten psychische Störungen, z.B.
Alzheimer
Chronisches Erschöpfungssyndrom
Depression
Essstörungen
Fibromyalgie
Bluthochdruck
Zwangsstörungen
und möglicherweise viele mehr (Tab. 3).
Liebermans Ausführungen passen gut zu der Idee der organismischen Selbst-regulation in einem Organismus/Umgebung-Feld. Der Autor führt viele Beispiele an, wie unsere evolutionsentwickelten Körper plötzlich in Konflikt geraten mit dem modernen Leben („steinzeitliche Körper in einer post-steinzeitlichen Welt“), u.a. bei Themen wie Krebsentstehung, in Schuhen vs. barfuß laufen, Nichtnutzung unserer Fähigkeiten, Übergewicht, ausufernde Hygiene („nur weil wir mit außergewöhnlicher Sauberkeit und Komfort leben können heißt das nicht, dass dies auch gut für uns sei“), Diabetes, Kurzsichtigkeit, etc.
Ein Beispiel zu den Auswirkungen des Sitzens (Kap. 12):
„Wenn Du in einem Standardstuhl sitzt, sind Deine Hüften und Knie rechtwinklig geknickt, eine Position, die deinen Hüftbeugemuskel permanent verkürzen kann. Wenn Du dann stehst, sind Deine verkürzten Hüftbeuger angespannt, so dass sie Dein Becken nach vorn neigen und so zu einer übertriebenen Lendenwirbelkurve führt. Der hintere Oberschenkelmuskel muss sich dann zusammenziehen, um dieser Krümmung entgegenzuwirken, was das Becken nach hinten neigt, was wiederum zu einer flachen Rückenhaltung führt und die Schultern nach vorn krümmt. Glücklicherweise erhöht Dehnen die Muskellänge und Muskelflexibilität effektiv.”
Eine Schlussfolgerung ist: „Jäger-und-Sammler benutzen ihre Rücken moderat – weder so intensiv wie Bauern, noch so minimal wie sitzende Büroarbeiter.“
Ein weiteres faszinierendes Ergebnis (zumindest für mich) betrifft das schmerzhafte Durchbrechen von Weisheitszähnen, das gemäß den Ausführungen des Autors auf zu wenig Kauen im Kindesalter zurückzuführen ist (was evtl. zu der Entwicklung von kleineren Kiefern führe, die nicht groß genug für Weisheitszähne seien). Noch ein weiteres interessantes Ergebnis ist, dass die Knochenstärke beim Menschen anscheinend nach dem Motto „keine Beanspruchung, kein Zugewinn“ bis zum 20.-25. Lebensjahr festgelegt ist (“danach kannst Du wenig machen, um Deine Knochen größer zu machen, und bald danach beginnt dein Skelett für den Rest Deines Lebens an Knochenmasse zu verlieren“).
Original:
Lieberman, D. (2013). The story of the human body: Evolution, health, and disease. New York: Pantheon Books.
Auf Deutsch:
Lieberman, D. (2015). Unser Körper - Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Frankfurt a. M.: Fischer.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 24. Juni 2019
Ist Bubers Ich-Du wesentlicher?
ahc, 09:55h
[Krümel]
“Vielleicht ist, wie Buber es vorschlägt, eine Ich-Du Beziehung eine wesentlichere Art, um einen Zugang dazu zu bekommen, wie die Dinge sind, als eine Ich-Es Beziehung. Ohnehin gibt es, wie ich vorschlage, keine guten Gründe dafür anzunehmen, dass der unpersönliche, objektive Standpunkt der einzige ist, durch den Dinge adequat enthüllt werden können." (S. 243, freie Übers. ahc)
Antwort von Philosophieprofessor Matthew Ratcliffe (Universität York) auf das Problem der argumentativen Zirkularität, die bei der Annahme entsteht, dass ein theoretischer Standpunkt der Welt Vorrang vor einem erfahrungsbasierten haben sollte:
"Warum sollten bestimmte kognitive Prozesse Vorrang haben?
Weil die Welt so und so ist.
Warum glaubst Du ist die Welt so?
Weil die Prozesse sie so enthüllen."
(ebd., freie Übers. ahc)
Ratcliffe, M. (2007). Rethinking commonsense psychology - A critique of folk psychology, theory of mind and simulation. New York: Palgrave Macmillan.
Ratcliffe hat auch eine Abandlung über die Phänomenologie von Depressionen geschrieben, in der er behauptet, dass "trotz des riesigen Forschungsumfangs zu Ursachen und Behandlung von Depression, die Erfahrung von Depressionen bisher kaum verstanden" worden ist. In seinem Buch beschreibt er eine neue phänomenologische Sicht:
Ratcliffe, M. (2014). Experiences of depression: A study in phenomenology. Oxford: Oxford University Press. (Kapitel 1 hier online einsehbar).
Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber diese Sicht wird für Gestalttherapeutinnen wohl nicht so neu sein.
“Vielleicht ist, wie Buber es vorschlägt, eine Ich-Du Beziehung eine wesentlichere Art, um einen Zugang dazu zu bekommen, wie die Dinge sind, als eine Ich-Es Beziehung. Ohnehin gibt es, wie ich vorschlage, keine guten Gründe dafür anzunehmen, dass der unpersönliche, objektive Standpunkt der einzige ist, durch den Dinge adequat enthüllt werden können." (S. 243, freie Übers. ahc)
Antwort von Philosophieprofessor Matthew Ratcliffe (Universität York) auf das Problem der argumentativen Zirkularität, die bei der Annahme entsteht, dass ein theoretischer Standpunkt der Welt Vorrang vor einem erfahrungsbasierten haben sollte:
"Warum sollten bestimmte kognitive Prozesse Vorrang haben?
Weil die Welt so und so ist.
Warum glaubst Du ist die Welt so?
Weil die Prozesse sie so enthüllen."
(ebd., freie Übers. ahc)
Ratcliffe, M. (2007). Rethinking commonsense psychology - A critique of folk psychology, theory of mind and simulation. New York: Palgrave Macmillan.
Ratcliffe hat auch eine Abandlung über die Phänomenologie von Depressionen geschrieben, in der er behauptet, dass "trotz des riesigen Forschungsumfangs zu Ursachen und Behandlung von Depression, die Erfahrung von Depressionen bisher kaum verstanden" worden ist. In seinem Buch beschreibt er eine neue phänomenologische Sicht:
Ratcliffe, M. (2014). Experiences of depression: A study in phenomenology. Oxford: Oxford University Press. (Kapitel 1 hier online einsehbar).
Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber diese Sicht wird für Gestalttherapeutinnen wohl nicht so neu sein.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 21. Juni 2019
Emotionswörter selten geschrieben
ahc, 06:50h
[Krümel]
Pennebaker, Mehl, & Niederhoffer (2003):"In Wirklichkeit können in der Alltagssprache, in emotionalen Schriften, und sogar in affekt-geladener Dichtung weniger als 5% der gebrauchten Wörter als emotional klassifiziert werden. Aus evolutionärer Perspektive gesehen ist Sprache nicht als Vehikel zum Ausdrücken von Emotionen entstanden. Wenn man die verschiedenen Studien zum Wortgebrauch anschaut, sticht heraus wie schwach Emotionswörter den Gefühlszustand von Menschen vorhersagen können." (S. 571)
Sind Menschen
es einfach nicht gewohnt Emotionswörter zu benutzen (weil andere Ausdrucksmöglichkeiten nützlicher),
haben sie nicht die Sprache
oder wollen sie ihre Gefühle
schriftlich nicht mit Hilfe von Emotionswörtern ausdücken?
Und wenn sie (unabhängig von irgend welchen Gründen) keine Emotionswörter schreiben, benutzen sie dann auch genau so wenige beim Sprechen (und übermitteln ihre Gefühle via anderen Modi)?
... link (0 Kommentare) ... comment