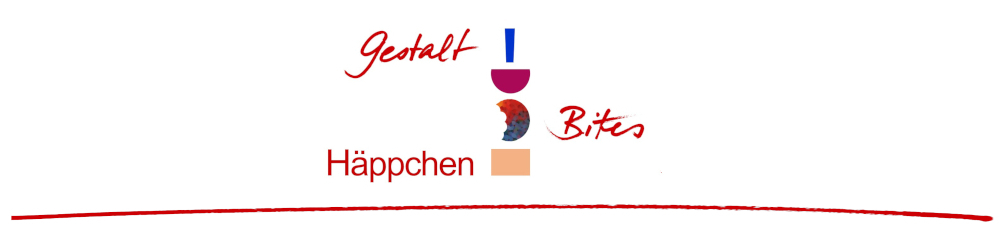Samstag, 6. Februar 2021
Werden wir bessere Therapeut*innen je mehr Klient*innen wir behandeln?
ahc, 10:50h
[erstere Eintrag nach Corona-Pause]
Und was macht überhaupt eine*n gute*n Therapeut*in aus?
Im Deutschen kennen sicher viele das Sprichwort “Übung macht den Meister.“ Während sich die Idee darin auf den ersten Blick richtig anfühlt, müssen wir bei näherer Betrachtung wahrscheinlich zugeben, dass nur korrekte Übung den sprichwörtlichen Meister macht. In ihrem Herausgeberwerk „Der Exzellenzkreislauf“ (The cycle of excellence) machen sich die Autoren auf den mühsamen Weg herauszufinden, was eine*n gute*n Therapeut*in ausmacht und wie jemand seine Psychotherapiefähigkeiten verbessern kann.
Sie benutzen das Konzept der „reflektierten Übung“ (deliberate practice) um das Phänomen zu erklären, wonach die meisten Therapeut*innen nach anfänglichen Verbesserungen im Laufe ihrer Karriereentwicklung auf einem mittlerem Fähigkeitsniveau stehen bleiben: Es scheinen nur solche Therapeut*innen im Laufe ihres Arbeitsalltags besser und besser zu werden, die viele Stunden in reflektierte Übung investieren – genau genommen 4,5 mal mehr Stunden als weniger effektive Therapeut*innen (S. 9). Wir lernen ebenfalls, dass sich im US-System postgraduierte Studierende hoch motiviert ins Psychotherapiestudium stürzen, jedoch nach ihrem Eintritt in die eigenständige Arbeit nur noch sehr diffuse Weiterentwicklungsmaßnahmen ergreifen und reflektiertes Üben (z.B. in Form von weiterführender Supervision, zusätzlichem Training in schwachen Bereichen oder selbstverordnete Evaluationsverfahren der eigenen Leistung durch Klienten) weniger herausfordernd und im Vergleich zu ihrem Studium auch weniger ansprechend finden (S. 13). Allerdings zeigt die Literatur, dass hoch-effektive Therpeut*innen sich gerade durch „Ausdauer und Leidenschaft im Hinblick auf Langzeitziele“ (Duckworth et al. zit. nach Rousmaniere et al. 2017, S. 13) auszeichnen.
Was macht also eine*n gute*n Therapeut*in aus? Oder, im Forschungsjargon formuliert: Welche Therapeut*innenvariablen sagen Psychotherapiewirksamkeit am besten voraus?
Die Liste solcher Eigenschaften und Verhaltensweisen von effektiven Therapeu*tinnen ist lang: die Fähigkeit, eine therapeutische Beziehung mit unterschiedlichsten Klient*innen aufzubauen, und unterstützende interpersonelle Fähigkeiten, die besonders bei „schwierigen“ Klient*innen sichtbar werden, stechen hierbei besonders heraus. Aber was sind denn „unterstützende interpersonelle Fähigkeiten?“ Darunter fallen neben den Klassikern wie Wärme und Empathie, emotionale Ausdrucksfähigkeit, hoffnungsvoller Optimismus, Problemfokussierung und Beziehungsfähigkeit interessanterweise genauso Überzeugungskraft, eine kohärente Behandlungsstrategie, professioneller Selbstzweifel und reflektiertes Üben (Wampold in Rousmaniere et al., S. 56ff). Das heißt., es haben gerade solche Therapeut*innen gute Therapieergebnisse, die überzeugt von ihrer Behandlungsmethode sind, die fokussiert auf das Problem der Klient*innen bleiben und die auch weiterhin ein bestimmtes Maß and Selbstzweifel daran mitbringen, ob ihre Behandlungsweise der*dem Klient*in auch dienlich ist. Die theoretische Orientierung ist dabei per se nicht ausschlaggebend, ebenso wenig wie das Alter, Geschlecht oder Beruf des*der Therapeut*in oder auch Manualtreue etc.
Hier ist kein Platz um alle Ratschläge des Kreislaufs aufzuführen, aber um die Eingangsfragen mit Hilfe der Hauptideen des Buchs zu beantworten: Nein, mehr Klient*innenstunden machen uns nicht automatisch zu besseren Therapeut*innen. Am wichtigsten ist, eine Methode zu finden, von der wir leidenschaftlich überzeugt sind, dabei neugierig auf andere Behandlungsmethoden zu bleiben und sich auf eine lebenslange professionelle Weiterentwicklungsnotwendigkeit (reflektiertes Üben) einzustellen, die wir auch als Modell gegenüber unseren Student*innen vorleben sollten. Und während reflektiertes Üben dabei auch nicht den perfekten Meister macht, bringt es uns doch näher ans Ziel unsere*n Klient*innen so gut wie möglich dienlich zu sein. Im Moment ist das die beste Option die wir als Therapeut*innen wählen können.
Rousmaniere, T., Goodyear, R. K., Miller, S. D., & Wampold, B. E. (Eds.) (2017). The cycle of excellence [Der Exzellenzkreislauf]. Wiley Blackwell.
Und was macht überhaupt eine*n gute*n Therapeut*in aus?
Im Deutschen kennen sicher viele das Sprichwort “Übung macht den Meister.“ Während sich die Idee darin auf den ersten Blick richtig anfühlt, müssen wir bei näherer Betrachtung wahrscheinlich zugeben, dass nur korrekte Übung den sprichwörtlichen Meister macht. In ihrem Herausgeberwerk „Der Exzellenzkreislauf“ (The cycle of excellence) machen sich die Autoren auf den mühsamen Weg herauszufinden, was eine*n gute*n Therapeut*in ausmacht und wie jemand seine Psychotherapiefähigkeiten verbessern kann.
Sie benutzen das Konzept der „reflektierten Übung“ (deliberate practice) um das Phänomen zu erklären, wonach die meisten Therapeut*innen nach anfänglichen Verbesserungen im Laufe ihrer Karriereentwicklung auf einem mittlerem Fähigkeitsniveau stehen bleiben: Es scheinen nur solche Therapeut*innen im Laufe ihres Arbeitsalltags besser und besser zu werden, die viele Stunden in reflektierte Übung investieren – genau genommen 4,5 mal mehr Stunden als weniger effektive Therapeut*innen (S. 9). Wir lernen ebenfalls, dass sich im US-System postgraduierte Studierende hoch motiviert ins Psychotherapiestudium stürzen, jedoch nach ihrem Eintritt in die eigenständige Arbeit nur noch sehr diffuse Weiterentwicklungsmaßnahmen ergreifen und reflektiertes Üben (z.B. in Form von weiterführender Supervision, zusätzlichem Training in schwachen Bereichen oder selbstverordnete Evaluationsverfahren der eigenen Leistung durch Klienten) weniger herausfordernd und im Vergleich zu ihrem Studium auch weniger ansprechend finden (S. 13). Allerdings zeigt die Literatur, dass hoch-effektive Therpeut*innen sich gerade durch „Ausdauer und Leidenschaft im Hinblick auf Langzeitziele“ (Duckworth et al. zit. nach Rousmaniere et al. 2017, S. 13) auszeichnen.
Was macht also eine*n gute*n Therapeut*in aus? Oder, im Forschungsjargon formuliert: Welche Therapeut*innenvariablen sagen Psychotherapiewirksamkeit am besten voraus?
Die Liste solcher Eigenschaften und Verhaltensweisen von effektiven Therapeu*tinnen ist lang: die Fähigkeit, eine therapeutische Beziehung mit unterschiedlichsten Klient*innen aufzubauen, und unterstützende interpersonelle Fähigkeiten, die besonders bei „schwierigen“ Klient*innen sichtbar werden, stechen hierbei besonders heraus. Aber was sind denn „unterstützende interpersonelle Fähigkeiten?“ Darunter fallen neben den Klassikern wie Wärme und Empathie, emotionale Ausdrucksfähigkeit, hoffnungsvoller Optimismus, Problemfokussierung und Beziehungsfähigkeit interessanterweise genauso Überzeugungskraft, eine kohärente Behandlungsstrategie, professioneller Selbstzweifel und reflektiertes Üben (Wampold in Rousmaniere et al., S. 56ff). Das heißt., es haben gerade solche Therapeut*innen gute Therapieergebnisse, die überzeugt von ihrer Behandlungsmethode sind, die fokussiert auf das Problem der Klient*innen bleiben und die auch weiterhin ein bestimmtes Maß and Selbstzweifel daran mitbringen, ob ihre Behandlungsweise der*dem Klient*in auch dienlich ist. Die theoretische Orientierung ist dabei per se nicht ausschlaggebend, ebenso wenig wie das Alter, Geschlecht oder Beruf des*der Therapeut*in oder auch Manualtreue etc.
Hier ist kein Platz um alle Ratschläge des Kreislaufs aufzuführen, aber um die Eingangsfragen mit Hilfe der Hauptideen des Buchs zu beantworten: Nein, mehr Klient*innenstunden machen uns nicht automatisch zu besseren Therapeut*innen. Am wichtigsten ist, eine Methode zu finden, von der wir leidenschaftlich überzeugt sind, dabei neugierig auf andere Behandlungsmethoden zu bleiben und sich auf eine lebenslange professionelle Weiterentwicklungsnotwendigkeit (reflektiertes Üben) einzustellen, die wir auch als Modell gegenüber unseren Student*innen vorleben sollten. Und während reflektiertes Üben dabei auch nicht den perfekten Meister macht, bringt es uns doch näher ans Ziel unsere*n Klient*innen so gut wie möglich dienlich zu sein. Im Moment ist das die beste Option die wir als Therapeut*innen wählen können.
Rousmaniere, T., Goodyear, R. K., Miller, S. D., & Wampold, B. E. (Eds.) (2017). The cycle of excellence [Der Exzellenzkreislauf]. Wiley Blackwell.
... comment